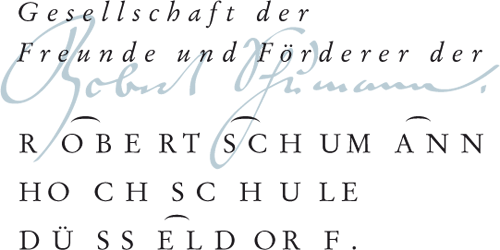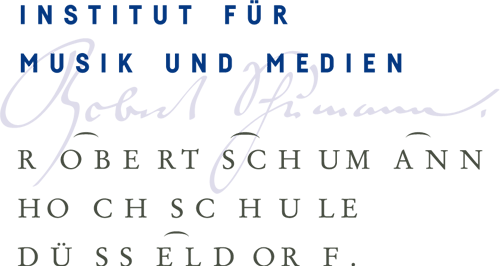Ein Projekt gegen das Vergessen
Die Ursprünge dieser Zusammenarbeit reichen in das Jahr 2013 zurück, als sich die sogenannten Reichsmusiktage zum 75. Mal jährten – eine Propaganda-Veranstaltung der Nationalsozialisten im Düsseldorfer Ehrenhof, auf der die Ausstellung „Entartete Musik“ Front machte gegen jüdische Komponist*innen und Musiker*innen sowie gegen Musikrichtungen wie etwa den Jazz. Der heutige Rektor der Hochschule, Prof. Thomas Leander, 2013 Prorektor für künstlerische Praxis und Förderungswesen, war Initiator dieses Erinnerungsprojekts.
Für die Umsetzung suchte er eine Band, die Haltung zeigt und die Werte der Hochschule teilt. „Um dieses Thema angemessen anzugehen, brauchte es einen Partner von hohem künstlerischen Rang. Einen Partner, der sofort um die Tragweite dieses Projekts weiß. Der unsere Werte von Pluralismus, Toleranz und Weltoffenheit teilt“, unterstrich der Rektor in seiner Laudatio.
Für das Projekt konnten die Toten Hosen gewonnen werden – eine Band, die sich bereits seit Jahrzehnten klar gegen Rechtsextremismus positioniert hatte. Gemeinsam entstand ein musikalisches Konzept, in dessen Mittelpunkt das Thema „Entartete Musik“ steht.
Musik als Teil der Erinnerungskultur
Die Gedenkkonzerte im Oktober 2013 in der Düsseldorfer Tonhalle waren ein großer Erfolg. Die CD erreichte Platz Zwei der Album-Charts. Campino übernahm in Arnold Schönbergs „Ein Überlebender aus Warschau“ die Sprecherrolle, weitere Stücke wie „Kol Nidrei“, Songs und Balladen aus der Dreigroschenoper von Kurt Weill und Bertolt Brecht sowie sinfonische Arrangements von Hosen-Songs ergänzten das Programm. Campino betonte damals: „Wir wollen mit unserer Musik die Erinnerung an das, was war, wachhalten – nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus Überzeugung.“
Rektor Leander beschreibt den gemeinsamen Arbeitsprozess als intensive Erfahrung: „Das Arbeiten an der Musik von Komponisten und Komponistinnen, die von den Nationalsozialisten wegen ihrer Herkunft, ihres Glaubens, ihrer politischen Einstellung oder ihrer Hautfarbe pauschal rassistisch diffamiert, verunglimpft, verfemt, politisch verfolgt und ermordet wurden, war ein langer und harter Weg. Dabei ging es darum, zu einer gemeinsamen Interpretation zu gelangen, die die Kraft und Schönheit der Musik zeigt, die diese Menschen trotz ihrer schrecklichen Lebensumstände erschaffen konnten.“
Auch Die Toten Hosen erleben diese Zusammenarbeit als etwas, das uns alle betrifft: „Die Themen Hass und Ausgrenzung gehen uns alle an. Wenn Musik helfen kann, Geschichte lebendig zu halten und Brücken zu bauen, dann ist sie genau da, wo sie hingehört.“
Sämtliche beteiligten Künstler*innen verzichteten damals auf ein Honorar, ebenso wie das Platten-Label JKP auf Gewinne: Bis heute fließen die kompletten Einnahmen in die Förderung von Stipendien und Konzertprojekten der Robert Schumann Hochschule.
Ehrenmitgliedschaft als Botschaft
Mit dieser Auszeichnung würdigt die Robert Schumann Hochschule nicht nur ein musikalisch herausragendes Projekt, sondern auch den Mut, sich als Künstler*innen klar zu gesellschaftspolitischen Fragen zu positionieren. An die Toten Hosen gewandt, fügte Rektor Leander in seiner Laudatio hinzu: „Wir überreichen Euch heute die Ehrenmitgliedschaft als Dank dafür, dass Ihr unseren künstlerischen Horizont und besonders auch den unserer Studierenden um wesentliche und eben auch politische Bedeutungstiefen erweitert habt.“
Übrigens: Campino hat in seiner Dankesrede auch der Robert Schumann Hochschule die Ehrenmitgliedschaft bei den Toten Hosen verliehen.
Der Festakt in der Presse: